☰
☰

aus Portraet
In DAS MAGAZIN des Tages Anzeiger, 21. März 2014
Ich habe keine Rituale. An einem Tag gehe ich raus, am anderen bleibe ich liegen. An einem Tag rauche ich eine, am anderen denke ich, ab heute rauche ich nie wieder. Das Einzige, was stets gleich bleibt, ist, dass ich aufs Klo muss, weil ich am Abend vorher so viel gesoffen habe. Denn wenn man kokst, kann man viel mehr Alkohol trinken.
Im Schnitt arbeite ich zehn Stunden am Tag und schlafe nur etwa vier Stunden. Wenn ich dann aufstehe und mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, schäme ich mich.
Weil sich in der Nacht zuvor einmal mehr dasselbe Spiel wiederholt hat: Ich komme nach Hause, bin todmüde, weil ich auch die Nacht vorher kaum geschlafen habe, und denke: Kann doch nicht sein, dass das schon der Tag war. Jetzt schaust du dir noch eine Doku im Fernsehen an. Dabei fallen mir die Augen zu, also sage ich mir: Jetzt ziehst du noch eine schöne Line und schaust die Doku zu Ende.
Aber das hat noch nie geklappt. Es gibt immer noch eine zweite und dritte Line. Dann denke ich, auf den Hunderter mehr oder weniger kommts jetzt auch nicht mehr an.
An den Tagen, die darauf folgen, ziehe ich mich bewusst gut an: schick- es Hemd, gepflegte Haare —das macht vieles wett. Man kann nicht mit kurzen Hosen und T-Shirt herumlaufen, wenn man nach Alkohol stinkt und Augen hat wie ein toter Fisch. Wenn ich in der Arbeit ankomme, sage ich meist gleich allen hallo. Dabei weiss ich genau, wer merkt, was ich
in der Nacht vorher gemacht habe, und wer nicht. Ich verachte die, die es merken, aber nichts sagen. Aber wenn sie was sagen würden, wäre es auch falsch.
Ich leite ein nobles Restaurant am Zürichsee, und ich bin überzeugt davon, gut in meinem Job zu sein, sein. Weil ich begriffen habe, was Men- schen brauchen. Es geht nämlich nicht darum, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Ich weiss, an welchem Tisch zum Beispiel ein Pärchen sitzt, das nur im Aperitif rührt und den Abend einfach nicht herumbringt. Die sind dir dafür dankbar, wenn du alle drei Minuten vorbeikommst und sie vollquatschst. Mit dem Koksdealen ist das ähnlich, jedenfalls bei mir: Ich liefere das Zeug nicht bloss ab, ich plaudere noch eine Stunde.
Als Dealer schaue ich heute in viele Leben rein; die Leute freuen sich extrem darüber, wenn ich zu ihnen komme. «Endlich bist du da», sagen sie. Ich kann dazu arrogant sein und Scheisse tun, und sie laufen mir trot- zdem hinterher. Zum Beispiel wenn mich einer anruft und ich genau weiss ich habe die Macht über sein Glück: «Weisst du was, ich unterhalte mich gerade, ruf mich in einer Stunde wieder an», sage ich, einfach weil ich keinen Bock hab. Das ist ein beschissenes kleines Kinderspiel. Aber, ganz ehrlich, es ist geil.
Ich bin jetzt 35 und ich hätte auch gern so etwas wie Stabilität. Eine Konstante. Es gibt ja Männer, die trinken jeden Morgen erst ihren Kaffee, und dann gehen sie sich als Frau verkleiden oder zur Arbeit in die Bank, je nachdem — aber wenigstens trinken sie jeden Morgen ihren Kaffee. Ich habe nichts, gar nichts Konstantes. Ausser Koksen.

aus Reportage
Sonntagszeitung vom 03.12.2017
Ob Santa Claus, Samichlaus oder Weihnachtsmann: Alle haben dieselbe Adresse hoch oben im Norden Finnlands. Wir haben den Mann, der schon 18 Millionen Briefe erhalten hat, in seinem Turm besucht.
«Lieber Santa, ich brauche ein Wunder», schreibt die neunzehnjährige Anna aus England. Sie faltet den handgeschriebenen Brief, legt ihn in einen weissen Umschlag, klebt ihn zu und schreibt: «Santa, Reindeer Land» auf den Umschlag. In die Ecke rechts oben klebt sie eine Ein-Pfund-Marke und wirft den Brief in den nächsten Briefkasten.
Lieber Samichlaus
Ich möchte einen blauen Regenschirm und einen gelben Regenschirm. Oder einen roten oder auch einen grünen. Das sind alles Farben, die mir gefallen. Oder eine andere Farbe. Rosa oder irgendeine andere Farbe. Einfach einen Regenschirm. Das ist alles.
Hanna
Der Brief wird ankommen. Genauso wie alle anderen, die mit dem Namen und dem Wohnort des Weihnachtsmannes, Samichlauses, Santa Clauses beschriftet werden. Selbst «Papa Noël au Ciel» auf Luftpostpapier hat den Weg gefunden zum wahren Samichlaus.
Der Samichlaus, der lebt nicht, wie allgemein im Volksmund verbreitet, in einer Hütte im nächstbesten Wald, nein, er kommt aus Finnland. Genauer genommen aus Lappland im Norden Finnlands, und zwar grad oberhalb des Polarkreises. Dort wohnt der «Joulupukki», wie ihn die Finnen liebevoll nennen, acht Kilometer ausserhalb der Stadt Rovaniemi in «Santa Claus Village» und empfängt in einem Holzturm das ganze Jahr hindurch Besuch. Und ganz viel Post. Das offizielle «Joulupukkiposti», das Postbüro des Samichlauses, hat bis zum heutigen Tag achtzehn Millionen Briefe aus 199 verschiedenen Ländern in Empfang genommen. China schreibt am meisten Briefe, gefolgt von Polen auf dem zweiten Platz und Italien auf dem dritten. Danach kommen Grossbritannien, Finnland, Japan und Russland.
«Wir behandeln alles, was mit dem Samichlaus zusammenhängt, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit», sagt Salla Tauriainen, PR-Verantwortliche von Visit Rovaniemi, und betont, dass «Samichlaus» keine Berufsbezeichnung sei, sondern es sich dabei um eine wirkliche Person handelt. Ein Finne, der in einer hiesigen Pizzeria arbeitet, ist ein wenig skeptischer: «Ich denke nicht wirklich, dass es den Samichlaus gibt. Das ist ein Märchen für Kinder, und im Turm da drüben sitzt ein Schauspieler unter dem Bart.»
Aber wer sitzt denn jetzt genau in diesem Märchenturm im Weihnachtsdorf? Das wollen wir wissen und bitten um eine private Audienz bei der Märchenfigur. «Der Samichlaus wird morgen eine Stunde früher für euch die Tür aufmachen», wer den wir informiert. «Das ist ein grosses Privileg, also seid pünktlich.»
Pünktlich um neun Uhr, eine Stunde bevor sich offiziell das Türchen seines Turmes öffnet, schütteln wir die Hand des Samichlauses. Wenn der Wirklichkeitscha-rakter des Joulupukki an seinem Bart gemessen werden könnte, dann muss dies hier der echte sein. Der lockig schneeweisse Bart wuchert fast bis unter die Augen und bedeckt den ganzen Bauch. An den Füssen trägt er riesige braune Filzpantoffeln. In der Ecke surrt ein kleiner Ventilator langsam vor sich hin, damit der Samichlaus nicht zu heiss hat unter seinen warmen Kleidern. Er klopft auf den Hocker neben sich. «Setzt euch, setzt euch. Schön, dass ihr da seid.» Er zeigt uns eine Kinderzeichnung vom Samichlaus mit seinem Rentier. Das Rentier ist sehr dick.
Lieber Samichlaus
Ich war die ganze letzte Woche sehr niedergeschlagen. Bitte lass mich dir mein Leid klagen. Ich habe mich sehr fest in ein Mädchen verliebt, aber sie hat mich mehr als einmal weggeschickt. Ich weiss, es ist Zeit aufzugeben. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte sage ihr, dass ich ihr frohe Weihnachten wünsche und sie vermisse. Vielen Dank.
Mit herzlichen Grüssen, Baihu (China)
Wann der Samichlaus morgens aufsteht? Irgendwann, wenn die Sonne aufgeht. Wie ist das denn, wenn die Nächte im Norden sehr kurz sind? «Dann muss ich sehr schnell schlafen», erklärt er und lacht, «aber das ist kein Problem, denn oberhalb des Polarkreises ist die Zeit magisch.» Und wie pflegst du deinen Bart? Ist der überhaupt echt? Der Samichlaus lacht. Er sei dreihundert Jahre alt, da habe man genug Zeit, sich einen langen Bart wachsen zu lassen. Ausserdem helfen ihm die Wichtel, ihn zu kämmen. Er habe sehr viele Wichtel. Er wisse nicht genau, wie viele, aber etwa so viele, wie er Rentiere besitzt.
Lieber Samichlaus
Es tut mir sehr leid, das ist jetzt wirklich mein letzter Brief. Ich würde nur gerne meinen Wunsch ändern. Ich hätte doch lieber ein paar Skinny Jeans statt Mario Kart. Danke.
Elaine
Das mit den Rentieren ist so eine Sache. Er habe ganz viele, aber Rudolf stehe ihm am nächsten. Wie er ihn gefunden hat? Es sei eher anders herum gewesen. Rudolf habe ihn gefunden. «Und das sage ich euch jetzt ganz vertraulich», er lehnt sich zu unserem Hocker und flüstert: «Aber Rudolf ist sehr eitel. Er hat mich nur ausgewählt, weil er findet, mein roter Mantel passt zu seiner roten Nase.»
Lieber Samichlaus
Wenn du Zeit hast, kannst du Fotos machen vom Schnee und von den Polarlichtern für mich? Wenn du das machen könntest, wäre ich sehr glücklich, ich will unbedingt die Sterne in Finnland sehen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören.
Jasmina (Taiwan)
Er kichert zufrieden und lehnt sich wieder zurück. Eine kleine goldene Lesebrille schaukelt auf seiner Nase. Die Augenbrauen sind weiss angemalt, und seine Hände sehen nicht alt aus. Am liebsten höre er Weihnachtslieder, und vor dem Einschlafen lesen er und die Wichtel sich Märchen von Andersen und Grimm vor. Hat er ein Lieblingslied oder ein Lieblingsmärchen? «Nein, ich mag sie alle.»
Und von was lebt der Samichlaus? Wie verdient er sein Geld? «In meiner Welt gibt es kein Geld und keine Geschäfte. Es ist die Welt der Märchen.»
Noch eine letzte Frage haben wir an den Samichlaus: Was macht er mit den bösen Kindern? «Ich weiss nicht», sagt er nachdenklich und legt sich einen Finger dorthin, wo das Kinn wäre, wenn man es sehen würde. «Ich denke, böse zu sein, das ist eher ein Problem, mit dem wir Erwachsenen zu kämpfen haben.» Damit hat er wohl recht, und damit ist unsere Besuchsstunde auch schon um, denn es ist fünf vor zehn. Selbst im April steht bei minus sechs Grad jetzt schon eine zwanzig Meter lange Schlange vor seiner Tür.
«Wartet, bevor ihr geht, gibt es noch ein Foto», sagt der Samichlaus und zeigt auf den Wichtel mit der grossen Kamera, der auf einer kleinen Empore steht und sich mit den technischen Aspekten befasst. Lächeln! Klick. «Danke», sagt der Samichlaus und schüttelt unsere Hände, «habt ein wunderbares Jahr und bis Weihnachten.» Sein Schnurrbart steht ein bisschen schief und verdeckt den Mund, aber er klingt so, als würde er darunter gerade lächeln. «Herzliche Grüsse an eure Leser!», ruft er uns noch nach. Dann zupft er die wollenen Kniestrümpfe zurecht und streicht sich erwartungsvoll über den Bart.
Lieber Samichlaus
Hilf mir, bitte. Niemand sonst kann mir helfen. Ich heisse Marta. Ich lebe in Russland, Moskau. Ich bin 48 Jahre alt, und ich habe keine Freunde. Ich bin sehr einsam. Ich möchte mich gerne mit jemandem anfreunden. Lieber Samichlaus, bitte hilf mir, Freunde zu finden.
Marta
Wir erhalten einen kleinen Zettel mit dem Downloadlink zu unserem Foto mit dem Samichlaus. Gewöhnliche Gäste zahlen dafür vierzig Euro, für uns ist es gratis. Der Weg führt hinaus in das Dorf voller Souvenirläden, wo sich Weihnachtszauber in allen Formen und Farben ersteigern lässt. Was man zu Weihnachten noch nicht geschenkt bekommen hat, lässt sich nun mit Sicherheit in einem der Läden finden. Für einen Euro kann man sich ein Diplom dafür ausstellen lassen, dass man einen Schritt über den nördlichsten Breitengrad getan hat. Und für fünfzig Euro darf man sich eine fünfzehnminütige Fahrt mit einem Husky-Hundeschlitten gönnen. Weil Rentiere eben doch eher langsam sind, zumindest wenn sie nicht gerade fliegen.
Man mag sich fragen, warum Menschen aus aller Welt sich immer noch an eine Figur richten, deren Glaubwürdigkeit aus einem angeklebten Bart und gefärbten Augenbrauen besteht. Man mag sich wundern, dass erwachsene Leute seitenlange Briefe an eine Märchenfigur richten und ihr das Leid klagen, fast so, als würden sie sie persönlich kennen. Spätestens hier, im Weihnachtsdorf in Rovaniemi, scheint es offensichtlich zu sein, dass sich Weihnachten in eine Art Disneyland verwandelt hat, in ein Geschäftsmodell und ein Produkt, das sich vermarkten lässt.
Lieber Samichlaus
Ich bin achtzehn Jahre alt und heisse Katharina. Ich möchte, dass meine Schwester Sara an Weihnachten nach Hause kommen kann. Ja, das ist ein Problem, denn sie studiert in Oxford, und sie hat nicht genug Geld, weil sie viele Rechnungen bezahlen muss. Ich vermisse sie aber, und ich wünsche mir, dass sie an Weihnachten zu Hause ist.
Ich komme aus der Slowakei. Es ist ein kleines Land. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
Alles Liebe Katharina (Slowakei)
Lieber Samichlaus
Das ist das zweite Mal, dass ich dir schreibe. Letztes Mal hatte ich mir ein Spielzeug gewünscht. Das war ein bisschen kindisch. Jetzt bin ich siebzehn und habe einen Freund. Ich wünsche mir wirklich, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Könnte ich dich vielleicht um ein hilfreiches Buch darüber bitten, wie ich eine Beziehung frisch und glücklich halte?
Betty (China)
Aber vielleicht ist objektive Wahrheit in diesem Kontext nicht so wichtig. Vielleicht geht es nur darum, den Menschen eine Figur zu bieten, an die sie ihre Wünsche richten können.
Und wahrscheinlich ist der Gedanke daran, dass irgendwo jemand ist, der unsere Wünsche hört, den unsere Wünsche interessieren, sogar viel wichtiger als das Wissen darüber, was möglich ist und was nicht. Für manche ist diese Instanz Gott, für andere das Universum, für kleine Kinder sind es Mama und Papa, und für einige ist es eben der Weihnachtsmann. Wenn das Joulupukkiposti also etwas beweist, dann ist es das: Die Menschen wollen eben immer noch träumen. Und an Wunder glauben.
Die richtige Adresse des Samichlauses lautet übrigens: Joulupukki, Joulumaantie 1, 96930 Rovaniemi.

aus Kurzgeschichte
Sometimes it rains through the roof, then he wakes up at night, with a sudden, rare clarity in his head, picks up a bucket and places it under the dripping spot. He has noticed that it happens more and more often, but he has not yet come to do anything about it. You’d have to call a person who can patch it up, talk to someone about money and material and things like that, which are now completely alien to him.
The house has fallen apart. Long cracks have dug into the plaster like river beds in a landscape. The ivy has grown, it is already covering some windows. And the leaves on the stone slabs change over the years into hummus, on which small, light green trees grow, which spread and will eventually burst the stone slabs with their roots. Somewhere, at some point, there was another gardener who sometimes swept away the leaves, but he can’t remember when he last saw him.
I’ve thought a lot about him, and gradually I know more about him than he does. He’s a thinker, a lost philosopher, he’s sitting in an old villa in Tuscany and he doesn’t like life, life as you know it, warm, cold, breathing out, going on or giving up. He likes to sit and he does a lot because he can think so much better and he thinks, but his thoughts get tangled up like the threads in a door frame in a strip club. He wants to go through the door once, loosen the threads, go on, see life, breathe in, breathe out, smell the air, but it doesn’t work, because he hangs in these threads and climbs up them like an animal, a very small one that can’t fly. There he climbs around in his thoughts and thinks and knows nothing. And I stand there and see him, every day when I clean the kitchen, put fresh figs on his table and think: get up. Or lie down. Or smoke a cigarette. Or jump into the swimming pool, even if there is no water. But do something so that you live. I could explain everything to him, about the threads, the figs, the world, the breathing, maybe even the love. Gladly about love. But then I think maybe he’s climbed too far up in the threads, maybe he’s too far up, and all he can do is let go and fall. I would catch him, but he would be so small and small that I would not find him, and he would fall into a crack between the stone slabs and I would look for him, but he would be gone.
A baby once drowned in the empty barrel in the inner courtyard, but he doesn’t know that. He doesn’t know much at all, not about what happened in the past and not about what will come in the future. But he likes to sit here in the courtyard of the old villa and think. He frowns and thinks about solutions, solutions for very specific things that make up the core of his life. You have to be able to explain it, there has to be a reason for all this, for the grief that sometimes knocks him down and leaves him paralyzed, for what people call joy or happiness or love. He doesn’t think so often about war, it’s a trifle, an outgrowth of the big inexplicable undergrowth that calls itself existence. He also doesn’t think about food very often, only when he opens the fridge and takes out a frozen pizza. When he eats the figs that the cleaning lady sometimes puts down for him, he does not think of the figs, but of this ball of threads in his head that have to be untangled, spread out and stretched out. One would have to tighten them, these threads that they can never move again, like guitar strings, so that one can play on them, with the precise certainty of what tone they would make of themselves. He would like to think of other things, figs for example, and perhaps even war or even peace, but he has no time until he has solved this great riddle.
When I come in the morning to sweep away the leaves or repair a wall that has long died anyway, I sometimes see him still sitting there, somewhere, at the edge of the pool, on one of the garden furniture, too lost in thought that he had covered it, the first morning dew on the seams of his jeans. And sometimes I think he’s dead, but then he blinks and I know he’s not dead yet. But I wonder how you can be so young and yet so dead. He writes everything down. He always has a notebook in his hand, sometimes a full one, sometimes not. Sometimes I find one in the leaves of the empty swimming pool or under the garden table or on the roof, and then I ask myself: What was he doing on the roof? Maybe he’s sitting there thinking and looking down and seeing more clearly because he’s further up and has no walls around him. Sometimes I look at the notebooks, and there are strange drawings, like threads, tense and rumpled, like balls, like the balls of yarn that my mother had in wartime, that had to be stretched with both arms so that the person opposite could wind them up. There are letters and numbers, too, but I don’t understand them, they’re not words, they’re something like equations, something like I once saw in school when I flirted with the girls in chemistry class. So there he is, somewhere in this shattered, disintegrated world, drawing these threads, and I know very well that it’s all over. He has broken through a wall that my father had broken through during the war, I saw it in his eyes.
Every evening he goes back into the house and switches on the light above the kitchen table. If he had a favorite time of the day, it would be that time. His head is tired, the ball of thoughts comes to a standstill. Slowly he can let it go, because he knows that he has to sleep so that he can think again tomorrow. He eats his lukewarm frozen pizza in the room where you had played the piano in another life. Then he goes up to the bathroom, washes himself, carefully and dutifully, and goes to bed. He never reads in bed. The bed is for sleeping. He closes his eyes and usually falls instantly into a deep sleep. This moment, this millisecond of not thinking before the world of dreams receives him in its realms, is the only reason why he is still alive. But he does not know that. Neither does he know that ghosts inhabit the house with him and that one day they will drive him away and he will stand on the street with nothing but formulas in his head.
Maybe it’s the house, and everything that happened here, the thing with the dead baby and the mother who broke her legs in the empty swimming pool, something like that can’t go unnoticed in a place like this. And maybe that’s the reason why I come so rarely, more and more rarely, until nobody thinks about me anymore and everyone has forgotten that I exist because I just don’t want to see how everything dies.

aus Kurzgeschichte
Sie hatte nur schnell pissen wollen, schnell da hochlaufen und pissen und vielleicht runterschauen. Sie kletterte die Böschung hoch, drehte sich so, dass sie den Weg sah, auf dem sie gekommen war, und hockte sich hin. Sie roch ihren Urin und die Erde, feucht und schwer, und noch etwas anderes, etwas Fremdes. Sie kramte ein Papiertaschentuch aus ihrer Jackentasche, machte sich damit sauber und liess es auf den Boden fallen.
Sie stand auf, der Wind streichelte über ihr Haar, und als sie sich umdrehte, sah sie das Meer. Sie hatte das Meer noch nie gesehen. Gehört davon hatte sie, sie kannte Bilder, Erzählungen, wusste, dass es existierte. Aber es hätte auch nur in Geschichten auftauchen können – so oft bis man fest daran glaubte, wie bei vielen Dingen, die man nie im Leben zu Gesicht bekommt. Sie aber sah das Meer zum ersten Mal in dem Augenblick, als sie den Reissverschluss ihrer Hose zuzog. Sie blickte in das Blau, das sich wie ein flüssiger Teppich bis zum Horizont erstreckte und sich dort in einem lila Nebel verflüchtigte. Es bewegte sich, strömte aber nicht in eine Richtung, sondern lag einfach da und lebte.
Und alles, was sie tun wollte, war hinunterzulaufen und es zu berühren. Jetzt tauchten auch all die anderen Bilder in ihr auf, von Wellen und Schaumkronen und Tieren, die sich schwerelos darin bewegten. Sie schossen durch ihren Geist wie Blitze, weckten ein Gefühl von Heimweh, von einer schweren, tiefen Trauer, die man aber lindern könnte, wenn man nur das Meer berühren könnte. Und so begann sie dem Zaun entlangzugehen, um das Meer zu suchen.
Sie lief und lief und lief und war sich sicher, dass der Zaun sie dorthin bringen würde, wo das Meer begann und wo es aufhörte; wo sich das Wasser erschöpft aufs Festland warf, immer wieder und wieder und wieder. Zuerst führte der Zaun am Ufer entlang, dann führte er durch den Wald und über Felsen, grau und spitz, und Erde, die schwarz war, nicht rot wie die Erde auf dem Hügel. Die scharfen Kanten der Steine bohrten sich in ihre Schuhsohlen und die schwarze Erde war staubig und trocken. Der Staub bäumte sich auf in kleinen Wolken und nistete sich dann überall ein, wo er Unterschlupf finden konnte: in den Nähten ihrer Kleider, zwischen ihren Zehen, in Nase und Ohren.
Sie hustete, stolperte, rieb sich mit dreckigen Fingern über die Augen und ging weiter und weiter, getrieben von ihrer Vorstellung des Zaunes, der zum Meer führte und darin versank. In diesem Bild ging das Gitter ins Wasser hinein wie eine Schlange und erstreckte sich dann weiter auf dem Meeresboden. Wale folgten ihm, um nach Hause zurückzufinden und Tintenfische krochen darunter hindurch, um zu ihren Nestern zu gelangen. Der Zaun, der ins Meer führte, grub sich so tief in ihren Kopf, dass sie an gar nichts anderes mehr dachte, alles andere war weg, fortgeblasen, ausgelöscht. Es war eine lautlose Welt, die sich in ihrem Kopf ausbreitete, und sie hörte tief in diese Stille hinein. Sie liess ihre linke Hand am Zaun entlangstreifen und fühlte, wie sich die Temperatur des Metalls veränderte, tastete über rostige und glatte Stellen, über kalte und warme, zerrissene und gerade.
Bald hörte sie vollständig auf zu denken und lief nur noch. Ihr Körper hatte die Trauer gespürt und wollte sie heilen. Ihr Magen verlangte Nahrung, ihre Beine sehnten sich nach Ruhe und ihre Haare wollten wachsen, aber alle ihre Organe hatten verstanden, dass sie nichts von alledem tun konnten, bevor sie am Ende dieses Zaunes angekommen waren und das Meer erreicht hatten. Sie trieben den Körper an mit einer Kraft, die jene von ihrer Seele noch übertraf. Sie wurde zu einer Masse aus Atomen, von denen jedes einzelne darauf zielte, das Meer zu finden.
Sie tastete sich weiter, auch in den Nächten, in denen sie einschlief, an den Zaun gelehnt, und umgekippt aufwachte, mit steifer Hüfte, den Kopf auf dem Boden. Sie setzte einen Fuss vor den andern, wie getrieben, anfangs mit festem Schritt, dann immer langsamer und langsamer, mit zitternden Gliedern, wie ein Schlafwandler. Ihre Hand begann zu bluten, aufgeraut von den rauen, rostigen Stellen, aber sie merkte es nicht, sie merkte nicht einmal, dass sie langsamer war als am Anfang und ging einfach nur weiter und weiter. Bis zum Ende, bis der Zaun sie nicht mehr über die Steine und das Dickicht ins Unbekannte führte, weil ihre Augen etwas erblickten, was sie anhalten liess.
Sie stand da und blickte auf das Papiertaschentuch auf dem Boden. Wenn der Zaun sich in den Norden verloren hätte, wäre sie für immer weitergelaufen, bis zu den Eismeeren, wo sie dann erfroren wäre, die Finger immer noch um die Drähte des Zauns gekrallt. So aber stand sie wieder an der gleichen Stelle und bewegte sich nicht. Als sie das Taschentuch lange anschaute, fiel ihr ein, dass sie wieder einmal pissen müsste und so hockte sie sich hin, aber es kam nichts, weil ihr Körper völlig vertrocknet war. Ihre Zunge lag schwer und pelzig in ihrem Mund, ihr Atem war flach und kaum hörbar, und der Boden begann sich langsam ihrem Gesicht zu nähern. Erst da merkte sie, dass sie vielleicht sterben würde. Nicht irgendwann, sondern jetzt, auf diesem Hügel aus roter Erde, von dem aus man das Meer sieht.
Da wollte sie wieder zurück, an den Anfang vor dem Anfang, zu dem Moment, als sie gesagt hatte: «Ich gehe schnell pissen.» Zurück in die Zeit, als sie das Meer noch nicht gesehen hatte. Sie wollte wieder zu den andern, deren Gesichter sie vergessen hatte. Aber sie wusste nicht mehr, wer sie waren, was sie vorher getan hatten und wo sie hergekommen waren. Sie versuchte Bilder in ihrem Gedächtnis zu finden, die etwas über damals verraten würden, aber ihr Geist hatte nichts mehr zu erzählen.
Ihr ganzer Körper begann zu schmerzen, weil er verstand, dass er das Meer nicht erreichen würde. Leere ergoss sich in ihre Seele. Und so kroch sie – denn gehen konnte sie nicht mehr – die Böschung hinunter, zwischen verbeulten Dosen, leeren Plastikflaschen und zerknitterten Papier-taschentüchern hindurch, und versuchte den Anfang zu finden. Aber Anfänge warten nicht, und wo für sie einmal alles angefangen hatte, da war jetzt nichts mehr. Nichts mehr ausser Abfall und ein paar Vögeln, die aufflatterten und über den Zaun davonflogen, als sie den langsam daherkriechenden Körper erblickten.
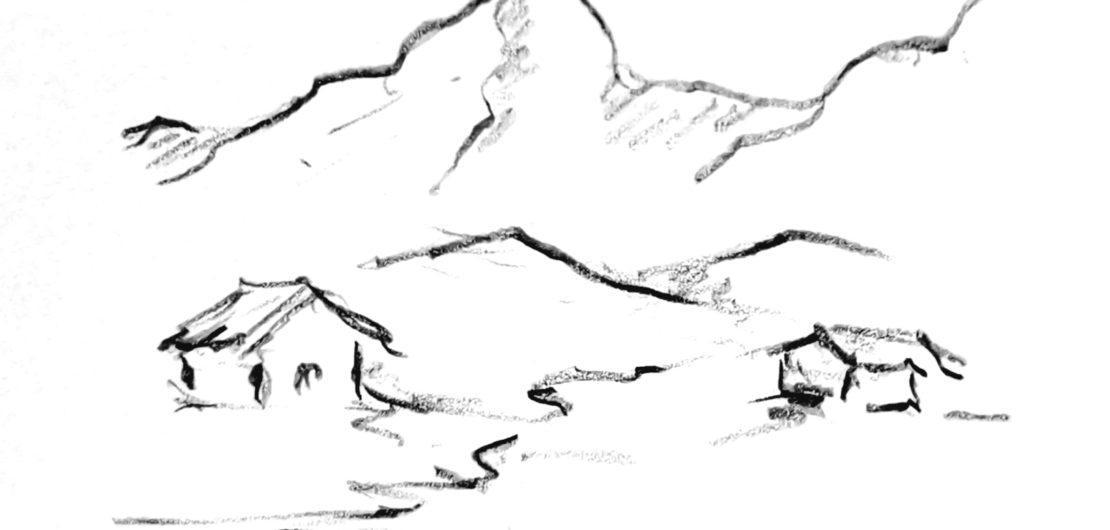
aus Short-Stories
It came upon them like a thunderstorm without clouds, like lava bursting out of a mountain, like the sea that suddenly flows into the land and covers everything up until there is nothing left. It began with a blue sky, a few birds chirped, as usual, in spring. Then the beet farmer looked over the fence and looked at the coal farmer’s huge, fat coal that was pouring out of the ground. The cabbage farmer came out of the house, wearing an old, worn shirt, under which a piece of his soft white belly looked out. He rubbed his bald head to wake up, for it was morning. The beet farmer didn’t like that. He sat on the wooden bench in front of his stone house, drank a bitter mixture of herbs (which he drank every morning so that he would be at least 205 years old), and turned up his nose. There he is, standing in the middle between his huge cabbages, and yet looks like one himself, thought the beet farmer, spitting contemptuously on the floor.
In the other houses, too, people began to cast strange glances at each other. A woman suddenly felt the desire to tear down her neighbor’s laundry, which had been painstakingly washed by hand, and throw it into the pig’s run. What she didn’t know was that she was looking out the window at the neighbor’s beloved cat and wanted to throw her into the mountain stream, where he plunges over the rocks into the valley. The cowherd walked down the street with a cow on a rope and saw a girl he had found terribly beautiful until the previous day. He had wanted to marry her. Now he looked at her as she was dribbling around with little feet, and felt a touch of disgust that grew stronger and stronger with every step he took as he approached her. As he walked past her, he stared at her only with a silent gaze. He would have liked to take her on a leash, like the cow, tied somewhere and kicked a little until she cried. The girl also looked at him, and although she had found him quite appealing until yesterday, she now angered his forward leaning body, which gave him a thoughtful look, and she wanted to see him frightened. The glacier monster was to fetch him, she mumbled before her and imagined him running down the mountain with his eyes wide open, while he was chased by the eternal ice with his green eyes.
The children also felt it. Then the little brother drilled his fingernail insidiously into the big sister’s arm until she screamed out loud. The act filled him with a gruesome satisfaction, for since he had woken up that day, her long blond curls that she combed every day annoyed him, and he began to forge a plan as to how he could light them on fire. The sister looked at the mother and found her sight
all of a sudden, it’s completely unbearable. She wanted to chase the mother out of the house and lock the door so that she had to sleep in the goat barn, where the animals would climb over it at night.
It had all started in the night. The basket maker had dreamed of hatred, and when he woke up in the morning, he failed to wash himself with the water he always fetched from the well in the evening. Until that day, he had never taken a step out of his chamber without splashing water in his face and emptying it to the floor behind the house. So all his dreams had seeped into the ground except for this day. But that morning he had not done so, so the hatred of his dream clung to him like pollen and the wind carried it to every corner of the place. He himself knew as little about the severity of his failure to wash as he could remember his dreams. So he looked helplessly and grimly out into the world and tried to give a leg to the healer who had just come down the mountain with fresh herbs.
What people did not notice was that her body began to change. Their eyes became narrow and their forehead wrinkled, as if they had to think about something terribly complicated without interruption. They stared around the area and could no longer hear the birds, because they only thought about who to throw into a pit or whose hair to light.
At first they thought that the moon might have hit the wrong place in the sky that night, or that some strange mood had fallen on the meadows with the morning dew. But after a few days they forgot what life had been like before the hatred had scattered throughout the village and only thought about how they could realize their ill-omened desires. So they half-heartedly ploughed their fields, pondered without motivation in their gardens, and shovelled manure without pleasure from the stables, always looking at the other people nearby. Shortly thereafter they stopped cooking, eating only the leaves from the trees and tubers they had torn out of the ground. They stopped washing and began to carve skewers with shining eyes. This unbearable glow in their chest, which deformed their faces and made them breathe quickly and flat, had to stop. The embers had to blaze and burn until the fire was out and you could walk barefoot over the soft ashes. There should be crying, suffering and wailing, until finally all those who were so infinitely pathetic were destroyed, packed away, buried, extinguished.
Exactly six days after the basket weaver’s dream had escaped, the beet farmer hit the cabbage farmer on the back of his head with a shovel. The cabbage farmer had stooped down to
to pick something up from the ground, and at that moment the beet farmer had been overwhelmed by his feeling. He had to go away, that cabbage farmer, that gigantic fat weakling, disappear, scream first and then be dead. To the sorrow of the beet farmer, the cabbage farmer did not scream, he simply fell dead, face down on the road. But with the first murder a gate had opened, and death flowed from the mountain down to the village. Soon they ran out of their houses and dark corners, with skewers and forks and sticks, to hear each other scream and suffer. But no one ran away, no one hid, no one suffered, because hatred had made them blind and insane, and they only sought to destroy each other while they themselves were being destroyed. The woman drowned her neighbor with the clean laundry, and the blonde-haired sister ran with burning hair through the village to chase her friend into the forest to be eaten by the wolves. The unfortunate woman burned to death before reaching her friend’s house. The friend was meanwhile pushed down from the roof by the tinker. So the monster came over her like a thunderstorm, it grabbed and shook the people, made them all mad predators equal, and destroyed them until all were gone, crushed, smothered, crushed and extinguished. The cowherd was the last one left. He dragged himself a few more steps along the road with his injuries, to see if he might not have seen someone alive he could stab with his pitchfork, but there was nobody left. And so he was content to insult a few corpses and bled to death on the open road.
A traveller found the village a few days later. He said that even the leaves had fallen from the trees and that all the flowers within a radius of ten kilometres had withered. No living creature had appeared, not even the call of a bird in the distance. The only living thing was the bowl of water that the basket maker hadn’t touched since that morning and was still standing on the ledge in his chamber.

aus Kurzgeschichte
Flecken ziehen vor meinen Augen hindurch. Schlafmangel. Wegen diesem Geruchsspiel und der Klangmassage gestern Nacht. Der Tisch hatte vibriert, als wir die Hände darauf gelegt hatten, und der Junge hatte erzählt, dass er über das Feuer gelaufen war. Die Nacht hatte sich zusammengefügt wie die Sechsecke der Bienenwaben. Ich spüre noch immer die Vibration der Harfe in meinem Körper und weiss, jetzt muss ich laufen, in die Berge gehen, um dieses Fossil zu suchen, diesen sandbedeckeckten Gletscher, der in sich zusammenfallen und sterben wird. Man fragt sich, ob er seufzen wird.
Vielleicht sogar Todesschreie ausstossen. Man weiss es nicht. Man weiss auch nicht genau, wann es passieren wird, aber es ist unabwendbar, unvermeidlich, unabdingbar und es wird bald passieren. Der Schnee auf den Bergen ist schon gegangen, der Sand ist danach heruntergerieselt. Felsen sind hinabgestürzt und haben hoffnungsvolle Schäfer mit ihren Schafen in den Tod gerissen. Jetzt ist da nichts mehr, nur Stein, loser und fester Stein, über den wir gehen. Wir steigen alle da hoch um ihn ein letztes Mal zu sehen, eine warme Hand an das kalte Eis legen und auf Wiedersehen sagen. Wir sterben wenn wir kalt sind, er stirbt, wenn er warm wird. So eigenartig ist das alles. Er wird daliegen wie ein gestrandeter Wal, glaube ich, wie ein gigantisches Tier, das einmal geherrscht hatte und nun völlig hilflos ist, und nur noch darauf wartet, dass sein Körper aufhört zerfällt. Ich denke die Haselnüsse in meinem Beutel und die Flasche mit lauwarmem Schwarztee und betrachte die anderen, die vor mir gehen, manche mit den Händen in den Jackentaschen, andere lassen die Arme müde am Körper herab baumeln. Wir gehen durch eine Welt, in der alles grau ist, der Himmel, der Boden, die Wolken, auch wir, die Menschen, die verstreut über die Felsen wandern, sind grau. So kann man gut nachdenken, wenn man einfach einen Fuss vor den anderen stellt in dieser grauen Luft, wo alles still ist und man nur aus weiter Ferne ein heiseres Pfeifen hört, weil der Wind Löcher in die Berge schleift. Ich stelle einen Fuss vor den anderen, manchmal auf feste und manchmal auf wackelige Steine. Ob der Gletscher weinen wird? Vielleicht fliessen seine Tränen über die Felsen, färben sie schwarz und verwandeln sich in Bäche, die bis ins Tal hinunter fliessen, dorthin, wo sich die Bauern über das Wasser freuen, bis sie merken, dass das nächste, was herunterkommt, der Berg sein wird. Der Berg wird herunterfallen und das ganze Dorf zermalmen, wird die fünfhundertjährigen Holzbalken der Deckengerüste zersplittern wie Streichhölzer. Auch die Kühe wird er zerdrücken, Blut wird in die Erde sickern.
Ein Falke zieht lautlos seinen Kreis. Auch er geht zum Gletscher. Man sagt, dass alle Tiere sich vor ihm verbeugen werden, bevor er geht. Selbst die, die sonst im Winter schlafen. Die Eichhörchen und die Igel und die Murmeltiere, alle werden noch ein Händchen oder eine Pfote auf das nasse Eis legen, um ihm auf Wiedersehen zu sagen. Der Falke dreht stumm und mit geschlossenem Schnabel seinen Kreis. Dann wendet er sich ab und fliegt in weitem Bogen davon gegen Norden. Ich denke an die Vibration, die in meinen Körper geflossen ist, als ich den Tisch mit der Harfe berührt hatte, und an den Jungen, der darauf lag und vom Feuer erzählt hatte. Am Sonntag sei er alleine in den Wald gegangen, erzählt er, habe Holz gesammelt und meditiert und abends, als das Feuer in sich zusammengefallen war, ist er über die Glut gelaufen. Ich spüre die Fäden der Harfensaiten an meinen Fingern, die summenden, weichen Töne, die übereinanderfallen und sich zu einem wellenartigen Geräusch vereinen. Der Geruch nach Tonkabohnen, Rosmarin und Feuerstein. Sie kann uns auch hypnotisieren, sagte die Frau in dem lila Kleid. Die Erinnerung an die Farbe tut mir weh. Nein,
hatte ich gesagt, weil das Schwarz unter ihren Augen verschmiert war, und sich wie Tränen bis in die Wangen hinunter zog. “Du musst dir nur immer wieder vorstellen, wie es sein wird dass es nicht weh tut, wenn du durch das Feuer läufst”, erzählte der Junge, “und dann wird es genauso sein.” Der Geruch nach Mandarinen. Ich erriet alles, sogar den Geruch von Gummi. Vielleicht wird er sich bewegen, der Gletscher, vielleicht wird er sich aufbäumen. Vielleicht ringt er mit dem Tod, weiss, dass er kommt, aber möchte ihn hinauszögern. Vielleicht ist es ihm nicht recht, dass man ihn besucht, dass die Menschen ihn behandeln wie eine Madonna in einer Kathedrale, auf Glück und Erlösung hoffend. Das Glück, das Glück. Wie es wohl klingt und welche Farbe es hat. Es ist in weiter Ferne, hinter den Steinen dieser grauen Unendlichkeit. Gestern hatte ich es gespürt, als ich an den Saiten der Harfe ziehen durfte und der Tisch vibrierte. Stell dir nur einfach vor, wie es sein wird, hatte der Junge gesagt und ich hatte ihn angeschaut und gedacht, ich könnte mit dir glücklich sein. Vielleicht hundert Jahre lang. Und jetzt setze ich einen Fuss vor den andern und spüre die kalte, lautlose Luft an meinen Wangen. Ich überlege mir, ob ich anhalten und ein paar Haselnüsse essen soll, aber es ist schon spät. Obwohl man früh aufgebrochen ist, hat die Sonne die höchste Stelle am Himmel bereits hinter sich gelassen, und ich sehe, dass die anderen immer schneller laufen. Ich beeile mich und grabe mit der Hand im Beutel, um eine Handvoll Nüsse hervorzukramen. Der Gletscher hat Schnee gegessen, und jetzt, wo es keinen Schnee mehr gibt, verhungert er. Man hatte ihn retten wollen, ihn mit Kühldecken zugedeckt, und das schien zu helfen, aber er verhungerte trotzdem, wurde kleiner und grauer und schwächer. “Toteis”, schrieb man in den Zeitungen, und manche behaupteten, er läge zwar noch da oben, habe aber bereits aufgehört zu leben. Bis man zum Schluss kam, dass er noch nicht tot sein konnte, denn er bewege sich immer noch, wechsle die Form, die Farbe. Man muss da hochgehen, sagten die Menschen, ihn berühren, die Hand ein letztes Mal auf das Eis legen. Einige glaubten, dass er sich mit Entschuldigungen und Opfergaben retten liesse, aber das waren die wenigsten. Ich habe Bilder gesehen von Menschen, die vor dem Gletscher barfuss auf ihren Knien lagen, tagelang, die Lippen spröde und aufgerissen, die Augen geblendet vom ewigen Grau. Sie hatten ihm Gaben gebracht, tote Tiere, die sie mit trockenem Grünzeug bekränzt auf das Eis legten, bis man sie weggejagt hat. Der Gletscher liess nicht nicht retten, er wurde nur schmaler mit der Zeit und man verstand, dass man gehen und ihn verabschieden musste, ein letztes Mal eine Hand an das Eis legen, das Eis das älter ist als wir alle, älter sogar als die Deckenbalken der Häuser im Tal. Ich frage mich, wie es riechen wird, wenn wir beim Gletscher sind, ob etwas in der Luft liegen wird, das vom Tod erzählt. Ich weiss gar nicht wo ich hingehe, ich laufe einfach den anderen hinterher, bis uns die ersten Menschen wieder entgegenkommen, und ich weiss: hinter diesem Hügel, da liegt er. Ich stolpere über die Anhöhe, müde vom ununterbrochenen Laufen und der schlaflosen Nacht. Da liegt das riesige Ungetüm, scheinbar ängstlich zwischen den Berggipfeln eingeklemmt. Eine klaffende Wunde in der Seite, man hat versucht, sich Stücke der Ewigkeit abzuschneiden und sie abzutransportieren. Vielleicht für Unsterblichkeit oder Gold. Man weiss es nicht.
Es ist ganz still. Das Pfeifen des Windes ist verstummt. Die Menschen gehen vorsichtig, wie auf Zehenspitzen, tasten sich an das Eis heran, legen die Hände daran. Manche setzen sich auf den kalten Boden und schauen sprachlos zu ihm hoch, die Lippen zu unverständlichen Gebeten geformt. Auch ich schleiche mich heran an das riesige Wesen und staune ob seiner Grösse. Es könnte die Tore öffnen, alles Wasser herausfliessen lassen und uns alle wegspülen, bis ins Meer. Vorsichtig lege ich meine Hand an das dreckige, sandige Eis und spüre eine brennende Kälte. Es ist eine traurige Kälte, die, wenn sie ein Ton wäre, aus einem sehr hohen i
bestehen würde. Er summt, der Gletscher, er schreit, in einem einzigen, langgezogenen, unaufhörlichen Schrei. Ich lasse meine Hand so lange auf dem Eis, bis ich nicht mehr weiss, ob sie kalt oder heiss ist, ich lausche dem Ton zwischen meinen Ohren und schliesse die Augen und sehe Flecken vor der Dunkelheit unter meinen Augenlidern hindurchziehen. Die Müdigkeit legt sich auf meine Schultern und in meine Beine. Ich denke an nichts. Erst als mich jemand am Ärmel packt und wegzieht, nehme ich die Hand weg, öffne die Augen, setze einen Fuss vor den andern. Meine Handfläche ist taub, ich grabe meine Fingernägel hinein und spüre nichts. Aber ich höre die Schritte der Menschen auf dem Geröll, sehe sie vor mir laufen, wieder zurück, da wo wir alle hergekommen sind, und folge ihnen. Auf der Anhöhe drehe ich mich um. Von weitem sieht die riesige Wunde aus als würde sie leuchten. Ich möchte mich auf die Steine setzen und hineinsehen bis das Leuchten weggeht. Aber die Menschen drängen mich, weiter zu gehen, es wird dunkel werden, sagen sie. Wie schön das Eis leuchten würde wenn es Nacht wäre, wenn da gar kein Licht wäre ausser dem Mond und den Sternen. Vielleicht findet er in jenen Momenten seinen Frieden, der Gletscher, wenn alle Menschen weg sind und der Schnee auch fort ist und er nur noch daliegt zwischen diesen nackten Bergen und nichts mehr zu tun hat als zu sterben. Meine Hand beginnt wieder warm zu werden und zu kribbeln, wie tausend kleine Nadeln schiesst der Schmerz in die Handfläche und ich denke an die Geräusche von Feuer, wie es knistert und knallt, und ich freue mich darauf, es zu hören.
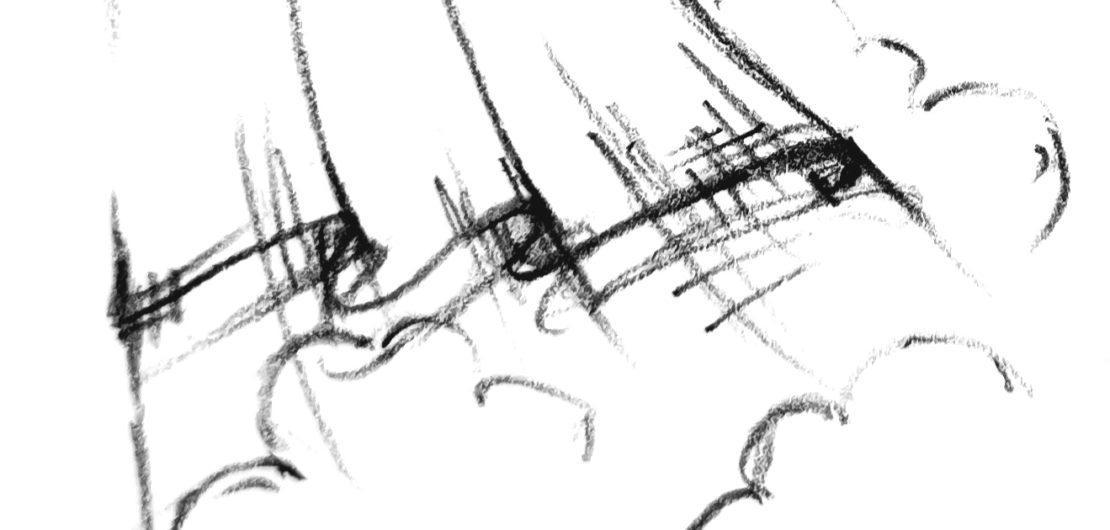
aus Short-Stories
I have woven a song out of threads that reach down to the ground. They are fine threads, pastel and light. When you pick them up, you don’t feel any weight. If you put one of them between two fingers and press them together, you don’t feel it, you only know that it is there. I took pastel threads because they are almost invisible. The loud tones are harder, hurt the ears and the heart. You can feel the fragile pale tones further down the body, in the stomach and in the hips. They vibrate, but we only feel it when we are completely still. These sounds travel far, can even cross oceans. They are said to meander along the surface of the water, over quiet waters and through storms and to climb out again on the other shore. I took the pastel threads because I know you’re far away and I want them to find you. I woven the honey melon and salmon threads together to produce the softest tones. They lie weightless and cool in my hands, and their soothing sound sings of an unusual harmony. Coral and sky blue entwine around them, frame them. These two sound like the songs that you hum to children to save them from nightmares. The steel blue thread runs through the song like biting tears, like cold dew on soft grass. I have woven them all confusedly, there is no rhythm and no chorus, only the threads that emerge and descend, wrapped in and around each other. I have knotted them well, they should hold, forever. And I left them long, so that the ends would drag along the floor when you put the song over your shoulder and carry it away. I would like to hang it somewhere where the wind can play with it, so the sounds can easily flow away. Nobody knows if the wind has anything to do with it, but I think you hear the song much clearer when it can move, the tones are carried away more easily. Maybe I’ll look for a place by the sea where I can hang it. But the salt in the air will fade the colours over time. Then only a single note will be left, a high vibration in the chest that could come from anywhere. But I want you to hear my song, with my threads that I left long. I have to find a good place for the song. I’m on my way now, carrying it until I find the rock where I can hang it. Maybe it will be a branch, or the skeleton of a rusty crane. I will find a place. It should be a spot with a little sun, so that the light can warm up the sounds. If there is sun and wind, I will leave the song and hope you hear it. I think you are far away. If you had stayed close, I would have woven another song, maybe even with some black threads, although the black ones sound dull and hollow and their sound dissolves immediately. If you had stayed close, I might not have woven a song at all. Maybe I would have searched for you and found you and brought you something you would have enjoyed. But because you are far away, I took the threads in soft colors and wove a song. The pastel tones can even hide between the clouds, they are so delicate. You will be able to hear the song for a long time, until the rain has eaten holes in it and its sounds unite with the rustling of the trees and the rippling of the rats. Then only a few threads will remain to dangle in the wind, there will be no more song, only a sound that cannot be distinguished from all the other sounds in the world. But until then it will take a long time, until then the song will flow to you over oceans for many years and you will hear it and maybe think of me or not.
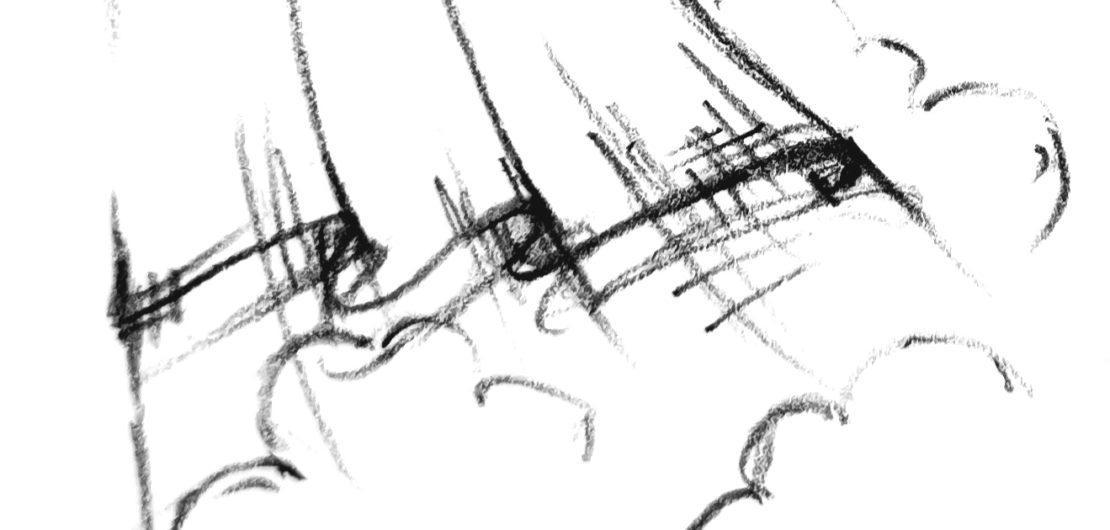
aus Kurzgeschichte
Ich habe ein Lied gewoben aus Fäden, die bis zum Boden reichen. Es sind feine Fäden, pastellfarben und leicht. Wenn man sie in die Hand nimmt, verspürt man kein Gewicht. Legt man einen Faden zwischen zwei Finger und presst sie zusammen, spürt man ihn nicht, weiss nur, dass er da ist. Ich habe pastellfarbene Fäden genommen, weil man sie fast nicht sieht. Die knalligen Töne sind härter, tun weh in den Ohren und im Herz. Die fragilen blassen Töne spürt man weiter unten im Körper, im Bauch und in den Hüften. Sie vibrieren, aber wir spüren es nur, wenn wir ganz still sind. Diese Töne reisen weit, können sogar Ozeane überqueren. Man sagt, sie schlängeln sich auf der Wasseroberfläche dahin, über stille Seen und durch Stürme hindurch,um am andern Ufer wieder rauszuklettern. Ich hab die pastellfarbenen Fäden genommen, weil ich weiss, dass du weit weg bist, und ich will, dass sie dich finden. Die Honigmelone- und lachsfarbenen Fäden habe ich miteinander verwoben, weil sie die sanftesten Töne ergeben. Schwerelos und kühl liegen sie in meinen Händen, und Ihr gemeinsamer Klang singt von einer ausgefallenen Harmonie. Koralle und Himmelblau ranken sich um sie, rahmen sie ein. Diese beiden klingen wie die Lieder, die man Kindern zum einschlafen vorsummt um sie vor Albträumen zu bewahren. Der stahlblaue Faden zieht sich durch das Lied wie beissende Tränen, wie kaltes Tau auf weichem Gras. Ich habe sie alle wirr durcheinander gewoben, es gibt keinen Rythmus und keinen Refrain, nur die Fäden, die auf- und abtauchen, sich in- und umeinander wickeln. Ich habe sie gut geknotet, sie sollten halten, für immer. Und ich habe sie lang gelassen, so dass die Enden auf dem Boden entlang schleifen, wenn man das Lied über die Schulter legt und wegträgt. Ich würde es gerne aufhängen, irgendwo, wo der Wind damit spielen kann, damit die Töne leicht wegfliessen können. Niemand weiss, ob der Wind etwas damit zu tun hat, aber ich glaube, man hört das Lied besser, wenn es sich bewegen kann, die Töne werden dann leichter davongetragen. Vielleicht suche ich eine Stelle am Meer, wo ich es hinhängen kann. Aber das Salz in der Luft wird die Farben mit der Zeit ausbleichen. Dann wird nur noch ein einziger Ton
zu hören sein von dem Lied, ein hohes Vibrieren im Brustkorb, das von überallher kommen könnte. Ich möchte aber, dass du mein Lied hörst, mit meinen Fäden, die ich absichtlich lang gelassen habe. Ich muss eine gute Stelle finden für das Lied. Ich mache mich jetzt auf den Weg, ich trage es, bis ich den Felsen finde, an den ich es hängen kann. Vielleicht wird es auch ein Ast sein, oder das Gerippe eines verrosteten Krans. Ich weiss noch nicht, wo ich es aufhänge, aber ich werde einen Ort finden. Es sollte ein Ort mit ein wenig Sonne sein, damit die Sonne die Töne aufwärmen kann. Sonne und Wind sollte es geben, und dann lasse ich das Lied sein und hoffe, du hörst es. Ich glaube dass du weit weg bist. Wenn du in der Nähe geblieben wärst, hätte ich ein anderes Lied gewoben, vielleicht sogar mit einigen schwarzen Fäden, obwohl die Schwarzen dumpf und hohl klingen und ihr Ton sich sofort auflöst. Wenn du in der Nähe geblieben wärst, hätte ich vielleicht gar kein Lied gewoben. Vielleicht hätte ich dich gesucht und gefunden und dir etwas mitgebracht, worüber du dich gefreut hättest. Aber weil du weit weg bist, habe ich die Fäden in den weichen Farben genommen und ein Lied gewoben. Die pastellfarbenen Töne können sich sogar zwischen den Wolken verstecken, so delikat sind sie. Du wirst das Lied lange hören können, so lange, bis der Regen Löcher hineingefressen hat und sich seine Klänge mit dem Rauschen der Bäume und dem Trippeln der Ratten vereinen. Dann werden nur noch einige Fäden im Wind baumeln, es wird kein Lied mehr geben, nur noch ein Geräusch, das sich von anderen Lauten in der Welt nicht unterscheiden lässt. Aber bis dahin wird es noch lange dauern, bis dann wird das Lied noch viele Jahre zu dir über Ozeane fliessen und du wirst es hören und vielleicht an mich denken oder auch nicht.
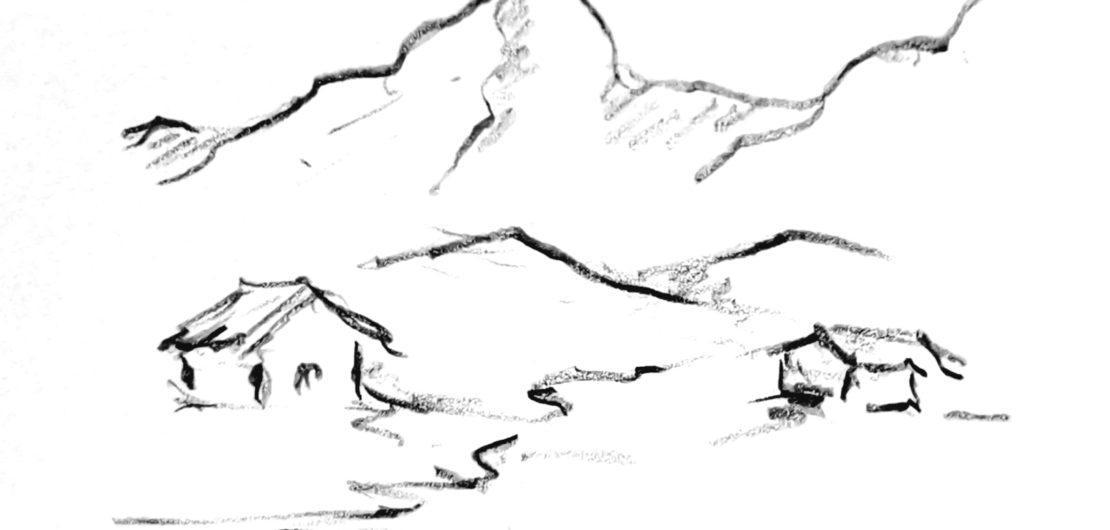
aus Kurzgeschichte
Es brach über sie herein wie ein Gewitter ohne Wolken, wie Lava, das aus einem Berg platzt, wie das Meer, das plötzlich ins Land fliesst und alles zudeckt, bis nichts mehr da ist. Es begann mit einem blauen Himmel, ein paar Vögel zwitscherten, so wie meist, im Frühling. Da schaute der Rübenbauer dem Kohlbauer über den Zaun und betrachtete dessen riesigen, fetten Kohle, die aus dem Boden quollen. Der Kohlbauer kam aus dem Haus, er trug ein altes, abgewetztes Hemd, unter dem ein Stückchen seines weichen weissen Bauches hervorschaute. Er rieb sich über die Glatze um sich aufzuwecken, denn es war Morgen. Dem Rübenbauer gefiel das nicht. Er sass auf der Holzbank vor seinem Steinhaus, trank eine bittere Kräutermischung (die er jeden Morgen trank, damit er mindestens 205 Jahre alt würde), und rümpfte die Nase. Da steht der, mitten zwischen seinen riesigen Kohlköpfen, und sieht doch selber aus wie einer, dachte der Rübenbauer und spuckte verächtlich auf den Boden.
Auch in den anderen Häusern begannen die Menschen einander eigenartige Blicke zuzuwerfen. Eine Frau verspürte plötzlich das Verlangen, ihrer Nachbarin die mühselig von Hand gewaschene Wäsche herunterzureissen und in den Schweineauslauf zu werfen. Was sie nicht wusste, war dass ebendiese aus dem Fenster auf die heissgeliebte Katze der Nachbarin schaute und Lust hatte, die Katze in den Bergbach zu werfen, dort, wo er über die Felsen ins Tal stürzt. Der Kuhhirt schritt mit einer Kuh am Strick die Strasse hinunter und erblickte ein Mädchen, das er bis am vorherigen Tag furchtbar schön gefunden hatte. Heiraten hatte er sie wollen. Jetzt schaute er sie an, wie sie mit kleinen Füsschen herumtrippelte, und verspürte einen Anflug von Abscheu, der immer stärker wurde, mit jedem Schritt, da er sich ihr näherte. Als er an ihr vorbeiging, starrte er sie nur mit stummem Blick an. Er hätte sie gerne an die Leine genommen, wie die Kuh, irgendwo angebunden und ein wenig getreten, bis sie weinte. Das Mädchen schaute ihn ebenfalls an, und obwohl sie ihn bis gestern noch recht ansprechend gefunden hatte, ärgerte sie jetzt sein nach vorne geneigter Körper, der ihm ein bedächtiges Aussehen verlieh, und sie hatte Lust, ihn verängstigt zu sehen. Das Gletschermonster sollte ihn holen, murmelte sie vor sich hin und stellte sich vor, wie er mit weit aufgerissenen Augen den Berg hinunterrannte, während er vom ewigen Eis mit den grünen Augen gejagt wurde.
Auch die Kinder spürten es. Da bohrte der kleine Bruder der grossen Schwester ganz heimtückisch seinen Fingernagel in den Arm, bis diese laut aufschrie. Die Tat erfüllte ihn mit einer grausigen Genugtuung, denn seit er an diesem Tag aufgewacht war, ärgerten ihn ihre langen, blonden Locken, die sie jeden Tag kämmte, und er begann einen Plan zu schmieden, wie er sie anzünden könnte. Die Schwester schaute auf die Mutter und fand deren Anblick
mit einem Mal völlig unerträglich. Aus dem Haus jagen wollte sie die Mutter, und die Tür zu sperren, so dass diese im Ziegenstall schlafen musste, wo die Tiere nachts über die Schlafende drüberklettern würden.
Es hatte alles in der Nacht begonnen. Der Korbflechter hatte vom Hass geträumt, und als er am Morgen aufwachte, versäumte er es sich mit dem Wasser zu waschen, das er abends immer vom Brunnen holte. Bis zu diesem Tag hatte niemals einen Schritt aus seiner Kammer getan, ohne dass er sich von dem Wasser ins Gesicht spritzte und es danach hinter dem Haus auf den Boden leerte. So waren bis auf diesen Tag alle seine Träume im Boden versickert. An diesem Morgen aber hatte er es nicht getan, darum blieb der Hass seines Traumes an ihm haften wie Blütenstaub und der Wind trug es in jeden Winkel des Ortes. Er selbst wusste genauso wenig über die Folgenschwere seines Nicht-waschens, wie er sich an seine Träume erinnern konnte. So schaute auch er hilflos und grimmig in die Welt hinaus und trachtete danach, der Heilerin, die soeben mit frischen Kräutern den Berg hinabkam, ein Bein zu stellen.
Was die Menschen nicht bemerkten, war, dass sich auch ihr Körper zu verändern begann. Ihre Augen wurden schmal und ihre Stirn runzlig, so als müssten sie ohne Unterbruch über etwas furchtbar Kompliziertes nachdenken. Sie stierten in der Gegend herum und hörten die Vögel gar nicht mehr, weil sie nur noch darüber nachdachten, wen man in eine Grube werfen oder wessen Haare man anzünden könnte.
Anfangs dachten sie, dass der Mond in jener Nacht vielleicht den falschen Platz am Himmel erwischt hatte, oder dass mit dem Morgentau irgendeine sonderbare Stimmung auf die Wiesen gefallen war. Aber nach wenigen Tagen vergassen sie, wie das Leben gewesen war, bevor der Hass sich im Dorf verstreut hatte und dachten nur noch darüber nach, wie sie ihre missgünstigen Sehnsüchte verwirklichen konnten. So pflügten sie halbherzig ihre Acker, grübelten motivationslos in ihren Gärten, und schaufelten ohne Lust den Mist aus den Ställen, immer nach den anderen Menschen schielend, die sich in der Nähe befanden. Kurz darauf kochten sie nicht mehr, assen nur noch die Blätter von den Bäumen und Knollen, die sie aus der Erde rissen. Sie hörten auf sich zu waschen und begannen mit glänzenden Äuglein Spiesse zu schnitzen. Dieses unerträgliche Glimmen in ihrer Brust, das ihre Gesichter verformte und sie schnell und flach atmen liess, musste aufhören. Die Glut musste auflodern und brennen, bis das Feuer ausgebrannt war und man barfuss über die weiche Asche laufen konnte. Geschrei soll es geben, Leiden und Jammern, bis endlich alle, die so unendlich erbärmlich waren, vernichtet waren, weggepackt, begraben, ausgelöscht.
Genau sechs Tage nach dem entwischten Traum des Korbflechters, schlug der Rübenbauer dem Kohlbauer mit der Schaufel auf den Hinterkopf. Der Kohlbauer hatte sich gebückt um
etwas vom Boden aufzuheben, und in diesem Augenblick war der Rübenbauer von seinem Gefühl übermannt worden. Er musste weg, dieser Kohlbauer, dieser gigantische dicke Schwächling, fort, verschwinden, zuerst schreien und dann totsein. Zum Leidwesen des Rübenbauers schrie der Kohlbauer nicht, er fiel einfach tot um, mit dem Gesicht auf die Strasse. Aber mit der ersten Mordtat hatte sich ein Tor geöffnet, und der Tod floss vom Berg hinunter ins Dorf. Bald rannten sie aus ihren Häusern und dunklen Ecken, mit Spiessen und Gabeln und Stöcken, um sich gegenseitig schreien zu hören und Leiden zu lassen. Aber niemand rannte weg, niemand versteckte sich, niemand litt, weil der Hass sie blind und wahnsinnig gemacht hatte und sie nur danach trachteten, den andern zu vernichten, während sie selbst vernichtet wurden. Die Frau ertränkte ihre Nachbarin mit der sauberen Wäsche, und die blondlockige Schwester rannte mit brennenden Haaren durch das Dorf, um ihre Freundin in den Wald zu jagen, damit sie von den Wölfen gefressen würde. Die Unglückliche verbrannte, bevor sie das Haus der Freundin erreichte. Die Freundin wurde währenddessen vom Kesselflicker vom Dach hinunter gestossen. So kam das Ungeheuer über sie wie ein Gewitter, es packte und schüttelte die Menschen, machte sie alle wahnsinnig gewordenen Raubtieren gleich, und vernichtete sie, bis alle weg waren, erdrückt, erstickt, zermalmt und ausgelöscht. Der Kuhhirt war der Letzte, der übrig blieb. Er schleppte sich mit seinen Verletzungen noch einige Schritte auf der Strasse entlang, um zu sehen, ob er nicht vielleicht noch jemand Lebendes erspähen konnte, den er mit seiner Mistgabel stechen konnte, aber da war niemand mehr. Und so genügte er sich damit, ein paar Leichen zu beschimpfen und verblutete auf offener Strasse.
Ein Reisender fand das Dorf einige Tage später. Er sagte, dass selbst die Blätter von den Bäumen gefallen seien und alle Blumen im Umkreis von zehn Kilometern verwelkt. Kein Lebewesen hatte sich mehr gezeigt, nicht einmal der Ruf eines Vogels in weiter Ferne. Das einzig Lebende war die Schüssel Wasser, die der Korbflechter seit jenem Morgen nicht mehr angerührt hatte und noch immer auf dem Sims in seiner Kammer stand.

aus Reportage
20 Minuten online, 20. August 2016
Muckis, Tattoos überall und das Apéroglas stets im Anschlag: Nirgends ist Zürich im Sommer cooler als am Oberen Letten. Die Drogenjahre sind vergessen.
“Ich ha d Lettechette aa”, sagt der 25-jährige Christian aus Maur und berührt die buddhistische Malakette an der nackten Brust. Warum? „Wils In isch.“ Ein Frauenhintern im glitzernden brazilian Bikini. Noch einer. Selbstbewusst zur Schau getragen. Vielleicht ist das ihr Lettenbikini, bereit für den Laufsteg vom Dynamo bis zum Primitivo. Da ein perfekt sitzender Lidstrich, dort ein eingeölter Männerkörper. Links ertönt deutscher Rap, rechts etwas lateinamerikanisches, vielleicht Reggaeton. Man wippt mit dem Fuss, trägt Sonnenbrille, trinkt Bier und ist cool. Es riecht nach Son- nencreme und Calvin Klein. Und ein wenig nach Limmat. Der Sommer ist da, und der obere Letten ist offen.
Europas grösste offene Drogenszene
Vor kaum mehr als zwanzig Jahren sassen unter der Kornhausbrücke noch Heroinjunkies. Hier schliefen, spritzten und starben die Fixer. Herge- bracht hatte sie die Suche nach dem Rausch, und geblieben sind sie unter dem Fluch einer bis dahin noch viel zu unbekannten Droge. Der Let-
ten hatte damit fast 3000 Menschen eine Bleibe gegeben. „Das ist mein Zuhause“, hatte die im Fernsehen porträtierte Fixerin Ursula Brunner damals gesagt und von der Kornhausbrücke hinunter gezeigt, „da kenne ich die Leute, da weiss ich wies geht und kenn mich aus.“ Spritzen, Scher- ben und Lumpen zierten das Flussufer. Im Jahre 1995 wurde der Letten leergeräumt, Ursula zog nach Adelboden, und die grösste offene Dro-genszene Europas verschwand für immer von der Bildfläche.
Mojitos unter Plastikpalmen
Manches ist seither gleich geblieben, etwa das Eisengeländer, über das heute die jungen Frauen und Männer in Badehosen und Bikinis klettern, um ans Wasser zu kommen. Sonst ist fast alles anders. Die Gleise sind weg, dafür steht dort jetzt ein Containerkomplex mit bunten Streifen: Das Primitivo, das mit Kiosk, Sonnendeck und Küche die Besucher versorgt.
Auf dem Dach darf man Mojitos und Negronis unter Plastikpalmen und neben echten Blumen schlürfen. Unten am Kiosk gibt es Bier, haus- gemachte Limonaden und ganze eineinhalb Deziliter Prosecco für nur neun Franken. Alles im Plastikbecher mit Depot, versteht sich. Scherben will man hier nicht, und auch die Umwelt will geschützt sein.
An den heissen Hochsommertagen reicht die Schlange manchmal bis hinunter zum Fluss. Die Damen tragen riesige Strohhüte, Bikinis und Schuhe, weil die Kieselsteine die Füsse piksen. Aber nicht irgendwelche Schuhe, nein, die ausgelatschten Flipflops sind daheimgeblieben. Weisse Plateauschuhe zum Beispiel – und dieses Jahr ziemlich oft sogar Stiefel. Cowboystiefel und weisse Badeanzüge, auf die dann die Sauce aus dem Tuna-Burger tropft.
Man schaut erwartungsvoll zur Kasse und hat keine Zeit zu verlieren, denn man sollte ja eigentlich irgendwo sein, und zwar unten auf dem Holz- steg. Dort breitet man sein Tuch aus, stellt den Miniaturlautsprecher hin, drückt auf Play, setzt die Sonnenbrille auf und schaut in die Welt hinaus. Mal schauen, wer sonst noch alles da ist. Mal schauen, was noch alles passiert.
Täglich ist Tattoo-Parade
«Da sind ganz viele, manchmal gar so viele, dass Freund und Freund sich fast nicht finden. Manch einer steuert in tropfender Badehose durch den tätowierten Fleischhaufen und schreit ins Smartphone: «WO bisch?» Man ist meist ein bisschen zu weit vorne oder ein bisschen zu weit hinten. «Ebe doch ufem Holz une! Ich ha doch gseit, mir sind bim Volleyballfäld obe!» Aber wie soll man sich denn finden, wie soll man überhaupt etwassuchen, wenn es so viel zu sehen gibt.
Allein die Tätowierungen sind einen Spaziergang durch die Badi wert. Es gibt Maori, Japanisches, Dotwork und seit einigen Jahren natürlich Bandeaus und Dreiecke. Ganz viele geheimnisvolle Daten. Geboren, ein- geschult, verliebt, verheiratet, gestorben. Oder so. Da hat sich einer grad mal das halbe Bein schwarz tätowiert, und dort ein anderer eine Ritter- rüstung. Hie und da sieht man noch, dass sie frisch gestochen sind. «Zwei Wochen lang nicht in die Sonne», heisst es eigentlich, aber wer eine neue Tätowierung hat, will die doch auch zeigen. Alt werden und verschwom- mene Linien auf dem Körper tragen kann man auch später noch.
Bauch einziehen!
Wer sich im oberen Letten auskennt, der weiss, dass man am besten beim Dynamo von der Brücke springt und sich dann bis zum Holzrost trei- ben lässt. Weil der Asphalt heiss ist, läuft man am besten ganz schnell auf dem schmalen Schattenstreifen des Geländers. Kinn raus, lächeln, und los. Darum geht die 26-jährige Carla nie in den Letten. «Ich hab das Gefühl ich muss den Bauch einziehen, wenn ich aus dem Wasser komme, und das mag ich nicht», sagt sie.
Oben bei der Betonmauer sind die Sprayer. Sie sind die Einzelgänger, hören Musik auf den Kopfhörern statt mit den Speakern und lassen sich vom coolen Treiben um sich herum nicht beeindrucken. Keine Son- nenbrille, dafür die Kapuze hoch. Was dabei an Kunst entsteht, ist teil- weise durchaus einen Blick wert, wenn man es schafft, von dem Menschen weg und hochzublicken. Niemand Aussenstehendes weiss genau, wer wann wessen Bild übersprayen darf. Aber vor einigen Jahren ist ein Graffi- ti die ganze Saison lang dagewesen. Man sagte, der Sprayer sei unverhofft ums Leben gekommen, und deshalb habe niemand sein Werk angefasst. Links davon sind die Beachvolleyballer. Wer noch nicht genug knackige Pos und Waschbrettbäuche gesehen hat, sollte hierhin kommen. Frau und Mann lassen vor aller Welt in Badehosen die Muskeln spielen.
Unter der Kornhausbrücke toben sich die Skater auf der Halfpipe aus. Noch mehr Waschbrettbäuche. Das beruhigende Surren der kleinen Räder auf dem Asphalt. Es wird lauter und leiser, kommt in Wellen wie Ebbe
und Flut. Die Skater kommen von überallher, auch von Baden und Luzern. «Hier ist es wie Sport und Ausgang gleichzeitig», erklärt der 20-jährige Lucas.
Mitte der 1990er war hier nichts
«Hier» war vor zwanzig Jahren erst einfach mal gar nichts gewesen. Vielleicht rannten mal ein paar Jogger den Fluss entlang oder ein Hunde- besitzer führte seinen Vierbeiner spazieren. Aber nach den Junkies war
der obere Letten zuerst leer gewesen und leer geblieben. Der Zürcher Gastronom Stefan Tamò stellte schliesslich zur Fussball-WM 1998 eine provisorische Bar mit Fernsehern auf, um die Spiele live am Fluss zu über- tragen, und hat damit das Primitivo ins Leben gerufen. Damals sei noch überall Stacheldraht herumgelegen und die grauen Betonwände hatten unbemalt in den Himmel geragt.
Das Einzige, was heute noch unbemalt ist, ist die Kornhausbrücke. An heissen Tagen stehen dort die wagemutigsten Besucher des oberen Letten. Vielleicht auch die betrunkensten. Zwischen Kornhausbrücke und Was- ser befinden sich zehn Meter freier Fall. «Ich bin vor drei Jahren einmal gesprungen und tue es nie wieder», erzählt die 30-jährige Gabriela und fasst sich an den Kopf, «ich hatte so Angst, ich bin fast ohnmächtig umge- fallen. Aber alle meine Freunde sind gesprungen, also wollte ich auch.»
Fast jeden Tag stehen sie da, junge Männer und Frauen in Badehosen. Vom Holzsteg aus kann man sie sehen, fast kann man sie zittern sehen
aus so weiter Ferne, oder man meint es zumindest. Dann klettert der Erste über das Geländer. Dann der Zweite. Der Erste klettert wieder zurück, traut sich doch nicht. Bis der Erste springt, wird manchmal siebenmal hin- und hergeklettert. Manchmal nimmt einer doch die Treppe hinunter, aber meist springt jeder, denn die andern tun es ja auch. Jedes Jahr ertrinken Menschen am Letten. «Meist so ein bis zwei pro Saison», erzählt einer der Köche des Primitivo, «aber das sind nicht jene, die von den Brücken springen, sondern meist einfach Jungs, die nicht schwimmen können oder zu betrunken sind oder beides. Dann kommt die Wasserpolizei und bringt die Leichen hoch, manchmal erst kurz vor der Schleuse.»
Nachschub holen an der Tanke
«Der Letten ist schon ein Art Zuhause für mich», stellt Anna (25) fest und nimmt einen Schluck Bier, «man kennt an fast jeder Ecke jemanden und man weiss halt, wies läuft.»«Alles fliesst im Letten», sagt Christian (44), «Wasser, Menschen im Wasser, und auch der Alkohol.» Er kommt fast jeden Tag hierher, um seinen Kaffee zu trinken und seine Zeitung in der Sonne zu lesen. Manchmal auch zum Apéro oder nach dem Apéro, «aber das sind dann die Abende die ich manchmal nicht mehr so präsent habe.»
Wem die Preise des Primitivo zu teuer sind und wer keinen Becher zurückbringen möchte, der geht über die Brücke in die Tankstelle, welche den Bedürfnissen der Lettenbesucher entsprechend ausgestattet ist. Bier, Prosecco, und Weisswein werden danach in Plastiksäcken am Gitter unter den dem Holzrost angebunden, damit sie im Wasser kühl bleiben.
Closing-Party als Schlusspunkt
Geht die Saison zu Ende, verbleiben unzählige bunte Plastikfetzen an den Gittern zurück und sind Zeuge des feuchtfröhlichen Treibens, das einen Sommer lang die Flussmeile beherrscht hat. Wenn mit dem Let- tenopening in Zürich der Sommer beginnt, endet er mit der Closing-Party im September. Dann wird es wieder ruhig im oberen Letten, Pullis werden über die Tätowierungen gezogen, man geht in gängige Clubs wie die Zukunft, das Hive oder die Büxe, verlagert das Sehen und Gesehenwerden an Orte mit einer Heizung.
Bis dahin aber will man schön sein, cool sein und dazugehören. «He hooooi! Scho mega lang nüm gseh!», heisst es. Man lehnt am Geländer, an welches sich schon die Junkies gelehnt hatten und schaut sich die Leu-
te an. Da und dort die Augen vielleicht einmal eine Sekunde länger auf andern verweilen lassen. Ein freches Zwinkern oder ein nettes Lachen darf schon sein. Wenn man nicht schon jemanden kennt, dann lernt man vielle- icht jemanden kennen. Ein wenig mit dem Fuss wippen. Bier trinken.
Um Mitternacht sind die Abfalleimer am Überquellen und zerdrückte Dosen zieren den Catwalk neben dem Fluss. Ein paar gebückte Gestalten gehen mit Kehrichtsäcken umher und sammeln den Abfall ein. Wenn es nichts mehr zu sehen gibt, verschwinden auch die Menschen, und alles, was zurückbleibt sind die stummen Zeugen eines zivilisierten Gelages. Man hört das monotone Rauschen des Flusses. Aus der Ferne erklingt noch Musik aus einem Handy, und die gedämpften Stimmen von ein paar Zurückgebliebenen. Was bleibt, ist der Geruch des Rausches. Früher waren es die andern, die Junkies, die die richtige Haltestelle im Leben verpasst hatten. Heute sind es wir mit dem Bier in der Hand. Nur einfach sauberer, erfolgreicher und vor allem: schöner.
Leave a Reply